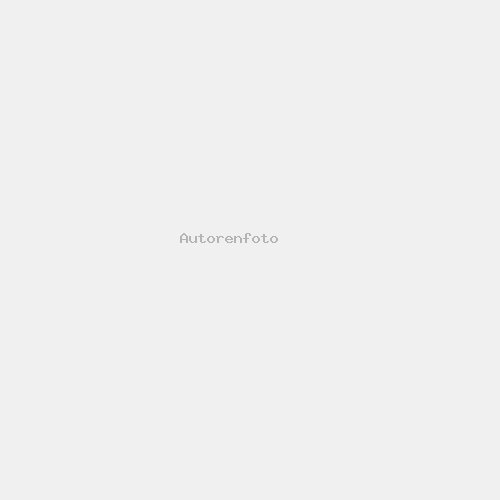Herkunftsnachweise für Ökostrom: System mit Schwächen braucht grundlegende Reform
von Nicole Weinhold 15.07.2025 | Druckvorschau © Trueffelpix – stock.adobe.com Pferde- statt Rindfleisch – das Pendant zu dem Skandal aus der europäischen Lebensmittelindustrie ist in der Energiewirtschaft der Verkauf von Herkunftsnachweisen an Kohleverstromer. Das System der Herkunftsnachweise (HKN) für Ökostrom weist erhebliche Schwächen auf und verfehlt derzeit wichtige Ziele der Energiewende. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Dem Klimaschutz tut man mit den europäischen Herkunftsnachweisen einen Bärendienst, glaubt man einer aktuellen Studie zu dem Thema. Herkunftsnachweise (HKN) wurden eigentlich eingeführt, um dem Grünstrom in den Handel zu verhelfen. Doch stattdessen begünstigen die Zertifikate nun Etikettenschwindel, so das Ergebnis eine Impulspapiers, das im Auftrag der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) erarbeitet wurde. Demnach ging es zunächst darum, Grünstrom mithilfe des HKN preislich aufzuwerten und auf diese Weise die Investition in Erneuerbare attraktiver zu machen. Der Handel mit HKN erfolgt europaweit und die Zertifikate haben eine Gültigkeit von zwölf Monaten. Das System ist also weitgehend losgelöst von den realen physikalischen Bedingungen der Stromproduktion und -verteilung. Die Entkopplung macht das Instrument laut Impulspapier anfällig für Zweckentfremdung und Missbrauch. Die neue Studie des FÖS legt nahe, dass Stromlieferanten die Zertifikate nutzen, um fossil erzeugte Strommengen mit Grünstromqualitäten auszustatten.Abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal – so sind Sie optimal informiert. Die wichtigsten Kritikpunkte des FÖS: Keine Anreize für den Ausbau erneuerbarer EnergienDie niedrigen und stark schwankenden Preise für HKN bieten kaum finanzielle Anreize für Investitionen in neue Ökostromanlagen. Der grenzüberschreitende Handel und die Ausstellung von HKN auch für bereits geförderte Anlagen in vielen EU-Ländern haben zu einem sehr niedrigen Preisniveau geführt. Statt in neue Anlagen zu investieren, ist es für Unternehmen oft günstiger, bestehende HKN aus dem Ausland zuzukaufen.Entkopplung von physikalischer RealitätHKN können unabhängig von den tatsächlichen Stromflüssen europaweit gehandelt werden – auch zwischen Ländern ohne Stromnetzverbindung. Zudem können zwischen Erzeugung und Nutzung bis zu 12 Monate liegen. Ignoriert werden auch die physikalischen Grenzen des Stromnetzes sowie die wetterbedingt schwankende Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.Uneinheitliche nationale Regelungen Während in Deutschland aufgrund eines „Doppelvermarktungsverbots“ keine HKN für geförderte EEG-Anlagen ausgestellt werden, ist dies in den meisten anderen EU-Ländern möglich. Die unterschiedlichen Regelungen führen zu Intransparenz und dazu, dass die steigende Nachfrage nach HKN in Deutschland zunehmend durch Importe gedeckt wird.Lesen Sie mehr zu Herkunftsnachweisen bei Wasserstoff.Gefahr der DoppelzählungIn einigen Fällen wurde Ökostrom doppelt angerechnet – einmal als HKN und zusätzlich im nationalen Strommix. Prominente Beispiele sind Island und Norwegen, wo Grünstrom sowohl für den heimischen Verbrauch als auch als exportierte HKN bilanziert wurde. Die Expert:innen empfehlen folgende Anpassungen: Verpflichtende Kopplung einführenHKN sollten verpflichtend an die tatsächliche Stromlieferung gekoppelt werden, wie es bereits für die Wasserstoffproduktion vorgeschrieben ist. Der Zeitraum zwischen Erzeugung und Verbrauch sollte maximal einen Monat betragen.Zeitliche und räumliche Komponente stärkenEine höhere zeitliche Auflösung (stündlich/viertelstündlich) würde die Schwankungen der erneuerbaren Erzeugung besser abbilden. Zudem sollte eine regionale Komponente eingeführt werden, die die physikalischen Transportmöglichkeiten berücksichtigt.Lesen Sie auch hier: Herkunftsnachweise bei SpeichernEuropäische Harmonisierung vorantreibenDie nationalen Regelungen zur Ausstellung und Anrechnung von HKN sollten vereinheitlicht werden. Bei einer Reform des Systems könnte auch das deutsche Doppelvermarktungsverbot überprüft werden.Digitalisierung nutzenDurch Automatisierung und digitale Plattformen könnten die Prozesse effizienter gestaltet und auch kleinere Anlagen besser eingebunden werden.Auch die Dena schlägt Anpassungen vor„Nur wenn HKN die physikalischen Realitäten des Stromsystems abbilden, können sie einen echten Beitrag zur Energiewende leisten“, fasst die Studie zusammen. Die vorgeschlagenen Reformen würden das System deutlich verbessern – allerdings sei dafür ein grundlegender Umbau nötig.Die Bedeutung des Themas nimmt zu. Eine Reform des Systems ist daher dringend geboten. Für Wasserstoff gelten die strengeren Auflagen, die FÖS auch für den Stromhandel fordert. Grüner Wasserstoff muss mit Strom aus Erneuerbaren-Anlagen hergestellt werden. Die Herkunft des Stroms wird über HKN nachgewiesen. Im Unterschied zum sonstigen Stromhandel gilt, die HKN sind an die Strommengen für die Elektrolyse gekoppelt, um Greenwashing zu vermeiden. Autoren: Nicole Weinhold